Schreiben an den Regierungsrat, 1921. Staatsarchiv Basel-Stadt, Politisches JJ 8.4, S. 298
Eine Erzählung von Rebecca Frommherz und Marianne Thiessen, entstanden 2018 im interdisziplinären Projekt „Krieg und Krise in Basel“ der Klasse 2MS (Geschichte und Deutsch) im Gymnasium Muttenz. Als Ausgangsmaterial und Inspiration dienten Archivquellen aus dem Staatsarchiv Basel-Stadt.
Es klopfte an der Tür. Elisabeth schob ihre Gedanken beiseite, lief den dunklen Gang zur Türe hinab und öffnete sie. Vor ihr stand eine schmale Frau von 25 Jahren. Nur ihr Bauch wölbte sich unter ihrem dicken Mantel. Ihre braunen Haare waren hochgesteckt und ihre liebevollen Augen zeugten von einer Anteilnahme, die Elisabeth Trost spendete. Draussen dämmerte es bereits und entsprechend der Jahreszeit war es ungemütlich kalt. Nach einer herzlichen Umarmung begaben sich die beiden Frauen in die vom Kamin geheizte Stube.
„Du hast geweint, stimmt’s?“, fragte Katharina ihre Gastgeberin. „Soll ich Tee aufsetzen? Dazu habe ich leider nur Brot, für mehr reichte das Geld nicht aus“, entgegnete Elisabeth ihr, ohne auf die gestellte Frage einzugehen. Dann, ohne irgendeine Reaktion abzuwarten, verschwand sie in der Küche. Nach wenigen Minuten kam sie mit einem Tablett zurück. Darauf stand dampfender Lindenblütentee mit zwei Tassen, dazu zwei Scheiben dunkles Brot. Sie setzte sich gegenüber von Katharina in den ockerfarbenen Sessel und seufzte. Dann begann sie: „Ich habe die Klage auf Schadensersatz letzte Woche am 5. Januar eingereicht. Hoffentlich dauert der Prozess nicht lange, ich brauche das Geld unbedingt. Mein Vermieter hat mir schon die dritte Mahnung geschickt, mir droht der Rauswurf. Klar, er versteht meine Lage, aber er braucht das Geld von mir, um seine eigene Familie zu ernähren. Weisst du, vor einem halben Jahr hatte ich noch finanzielle Unterstützung von Rosa und Alfred, aber wieso sage ich dir das? Das weisst du ja auch. Ich bin doch an allem selber schuld.“
„Ich war es, die meine jüngste Tochter zum Einkaufen geschickt hatte. Eigentlich wollte ich selber gehen, doch ich fühlte mich nach dem Verlust meines Mannes nicht stark genug, um unter die Leute zu gehen. Also machte Rosa sich auf den Weg, um Kartoffeln, Karotten und etwas Brot zu kaufen. Sie kam nicht mehr zurück. Wieso musste genau an diesem Tag der Generalstreik stattfinden? Weshalb war meine Tochter gerade über den Kasernenhof zu Jauslins Geschäft gelaufen? Wieso musste dieser Soldat genau sie erschiessen? Wieso nicht jemand anders? Sie war doch schuldlos. Als ich das Klopfen hörte, dachte ich, sie sei zurück. Doch als ich die Türe öffnete und die Polizisten sah, ahnte ich nichts Gutes. Sie baten mich, mit ihnen zu kommen. Es gehe um meine Tochter. Wir stiegen in ein Auto und fuhren los. Von der Brücke aus, die wir überquerten, sah ich den Rhein. Er floss unaufhaltsam. Unaufhaltsam wie das Leben. Auf dem ganzen Weg sagte niemand ein Wort. Gewitterwolken waren aufgezogen. Kühler Wind wehte durch die Strassen und liess die Baumkronen hin und her schaukeln. Nach fünfzehn Minuten kamen wir im Pathologischen Institut des Bürgerspitals an. Die Tür wurde geöffnet und ein Polizist begleitete mich ins Untergeschoss. Vor einer Türe stand ein Mann von etwa fünfzig Jahren. Er trug einen bis zum Knie reichenden Kittel. Knapp und sachlich begrüsste er uns und öffnete die Türe. Und dann sah ich sie. Mitten in dem kalten, kahlen Raum, der spärlich mit ein paar Glühbirnen ausgeleuchtet war, lag sie aufgebahrt. Eine grüne Abdeckung lag über ihrem Körper, nur ihr Kopf war sichtbar. Ich trat an das Metallgestell und betrachtete meine Tochter. Sie sah aus, als würde sie schlafen. Ihre blonden Haare lagen wie ein Heiligenschein um ihren Kopf. Doch sie sah blass aus. Leichenblass. Nun endlich erklärte mir der Polizist, was geschehen war. Sie war in eine Gegenüberstellung von Streikenden und Soldaten geraten. Als einer der Streikenden sich vordrängte, um einen Soldaten anzugreifen, brach ein Tumult aus. Plötzlich war ein Schuss zu hören, er hatte sich während dem Gerangel gelöst und willkürlich sein Opfer von hinten auf Herzhöhe getroffen. Jede Hilfe kam für sie zu spät. Es war nicht mit Absicht passiert.
Die Worte des Polizisten klangen in meinem Kopf. Immer wieder. Wie ein nie endendes Karussell. Mir wurde schwindlig. Was er danach sagte, hörte ich nicht mehr. Nur ein Rauschen, welches immer stärker und aufdringlicher wurde. Mein Sichtfeld wurde schummrig, dann schwarz.
Das Klirren der Teetasse, die Katharina abstellte, holte sie wieder ins Hier und Jetzt. Ihre Gedanken hatten sich wieder überschlagen, wie schon so oft in den letzten paar Wochen.
„Sei vernünftig, liebe Mutter. Hier, nimm das Taschentuch und putz dir die Nase“, redete Katharina ihrer Schwiegermutter zu. „Du machst dir schon zu lange Selbstvorwürfe. Dich trifft keine Schuld, das weisst du genau so gut wie ich. Du musst nach vorne blicken, wieder in den Alltag einsteigen. Komm doch wieder in den Chor, wir vermissen dich schon und machen uns Sorgen. Weisst du, wir singen gerade ein Stück von Mendelssohn. Es würde dir bestimmt gefallen. Du hast genug geweint, es ist Zeit für einen Neuanfang.“
„Du hast ja recht, aber einfach ist es nicht. Ich werde mir Mühe geben. Erzähl mir etwas Schönes von deinem Alltag, ich habe von meinem Sohn gehört, dass du neue Schüler hast.“
„Ja, ein Junge und zwei Mädchen. Der Junge und eines der Mädchen sind Geschwister aus einer Arbeiterfamilie, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie abgemagert sie sind. Und das andere Mädchen, ihr Vater ist ein wohlhabender Firmenbesitzer, sitzt mit ihrem Pausenbrot auf der Bank und versteht gar nicht, wieso die zwei sie so neidisch anschauen. Aber sonst macht mir der Beruf Freude. Nicht nur, dass ich gerne mit Kindern zusammen bin. Es macht mich glücklich, sie innerlich und äusserlich wachsen zu sehen. Sie machen zu Hause viel durch mit den Konsequenzen des Krieges. Aber am meisten freue ich mich auf mein eigenes Kind. Jeden Tag, an dem es wächst, spüre ich das Leben in mir“, sagte Katharina, während sie sich liebevoll über ihren Bauch strich.
„Das freut mich sehr für dich. Weisst du, nach dem Tod meines Mannes und meiner geliebten Tochter, war das das Einzige, was mich aufmunterte.“ Ihre grünen Augen strahlten zum ersten Mal seit Langem wieder einen Anflug von Freude aus. Freude? Die hatte sie schon lange nicht mehr empfunden seit jenem verhängnisvollen Tag.
Rosa und ich liefen die Strasse entlang. Wir hatten unsere Arbeit beendet, sie in ihrer Schneiderei, ich als Haushälterin, und waren auf dem Weg nach Hause. Wir hatten gerade unseren Lohn bekommen, 84 Franken pro Woche für uns beide, und hatten beschlossen, einkaufen zu gehen. Zuhause fehlten ein paar Sachen. Gemüse war schon lange rar, doch wir wollten wieder einmal eine Gemüsesuppe kochen. Ausserdem brauchte Alfred noch seine Medikamente, um seine abklingende Bronchitis zu behandeln. Also gingen wir zum Jauslin, um einzukaufen. Doch allzu viel konnten wir uns nicht leisten, denn Herr Schmidlin wartete schon länger auf den unbezahlten Mietzins. Als Hausbesitzer war er ein recht herzlicher Mensch. Doch auch er musste für seine Familie sorgen. Mit dem Lohn von Alfred, Rosa und mir kamen wir gerade über die Runden.
Als wir zu Hause ankamen, war mein Mann schon von seiner Arbeit bei der Strassenbahn zurückgekehrt und begrüsste uns. Abgespannt von der Arbeit legte er sich auf das Sofa, während wir in die Küche gingen, um das Abendessen vorzubereiten. Ich war gerade dabei, die Karotten zu schälen, als ich ein Husten aus dem Wohnzimmer hörte. Ich dachte mir nichts dabei und setzte meine Arbeit unbeirrt fort. Doch als es nicht aufhörte, nahm ich ein Glas Wasser und ging ins Wohnzimmer, um es meinem Mann zu geben. Es war nicht fremd, meinen Mann husten zu hören, denn der chronische Husten plagte ihn schon seit Monaten nach der starken Bronchitis. Beim Betreten der Stube, bot sich mir ein schockierendes Bild. Vornüber gebeugt, sass er da auf dem Sofa und schnappte nach Luft. Sein weisses Unterhemd war mit Blut bedeckt und bei jedem Husten spuckte er mehr Blut aus. Panik breitete sich in mir aus. Ich liess das Glas fallen und stürzte auf meinen Mann zu. Er keuchte meinen Namen und flüsterte, dass es ihm leid täte, mich mit den sechs Kindern alleine zu lassen, doch diese verfluchte Bronchitis würde ihm das Leben kosten. Mit einem letzten Husten lehnte er sich zurück, schloss die Augen und sackte zusammen. Er war tot.
Viele Nächte lang konnte ich nicht schlafen. Die Einsamkeit und Trauer verwandelten mich in einen gefühlstauben Menschen. Nur Rosa vermochte es, mir in dieser Zeit beizustehen. Tagsüber ging sie arbeiten, vor und nach der Arbeit kümmerte sie sich um mich. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Nicht nach dem Tod meines Mannes. Es tat mir zu sehr weh. Also verlor ich nach fünf Tagen auch meine Arbeitsstelle. Sie hatten schon Ersatz für mich gefunden.
Mit einem Lächeln im Gesicht stand Elisabeth auf und lief zielgerichtet zur Wand, an der ein Familienfoto hing. Es war noch nicht sehr alt und hing in einem dunkelbraunen Holzrahmen. In der Mitte war sie mit ihrem geliebten Mann zu sehen. Um das Paar herum standen ihre sechs Kinder: Von Rosa, der Jüngsten, bis zu Karl, dem Ältesten, mit seiner Frau Katharina.
„Bald wird die Familie wieder Zuwachs bekommen. Das haben wir dringend nötig. Weisst du, du hast eigentlich Recht. Ich muss wieder leben lernen. Wenn ich den Schadenersatz bekomme, werde ich damit meinen eigenen kleinen Laden eröffnen. Dann bin ich wenigstens finanziell unabhängig von meinen Kindern. Meinst du, ich könnte auch wieder im Chor quer einsteigen?“, fragte Elisabeth zögernd, den Blick immer noch auf dem Bild haftend.
„Sicher, wir brauchen jede Stimme, die wir haben können. Nächsten Donnerstag findet die nächste Probe statt. Wir zählen auf dich.“
Epilog
So oder so ähnlich wird es wohl stattgefunden haben, im Januar 1920 in der Alemannengasse 27 in Basel. Das Leben ging weiter, auch für die Witwe Elisabeth Hunziker-Keller. Nachdem sie am 5. Januar 1920 die Klage für Schadenersatz eingereicht hatte, brauchte sie noch viel Geduld, bis sie den Ersatz erhielt. So war der einzige Verdienst, den die Familie nach dem Tode des Vaters und der Tochter Hunziker noch hatte, der Lohn der Tochter Martha. Dieser war nur spärlich, musste aber ausreichen. Auch der Sohn Karl half gelegentlich für den Hauszins aus. Zwei lange Jahre befand sich die Familie daher in grösster Not und war auf Unterstützung angewiesen. Das anfängliche Ersatzbegehren des nun fehlenden Verdienstes betrug 8600 Franken. Am 23. Oktober 1922 erklärte sich Elisabeth Hunziker schliesslich mit der vom Justizdepartement des Kantons Basel-Stadt angebotenen Offerte von 3000 Schweizerfranken einverstanden. Es war keine einfache Zeit. Sie musste viel kämpfen und hatte grosse Sorgen. Doch sie fing wieder an, im Chor zu singen, und auch das kleine Baby erfreute ihr Herz, denn es hatte die gleichen blonden Haare wie Rosa und auch ein Glänzen in den Augen, wenn es zu ihr hinaufsah und sie anlächelte.
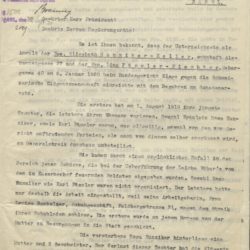
Neueste Kommentare