Schreiben an den Bundesrat, 1921. Staatsarchiv Basel-Stadt, Politisches JJ 8.4, S. 453
Eine Erzählung von Lisa Güetli und Gina Pelosi, entstanden 2018 im interdisziplinären Projekt „Krieg und Krise in Basel“ der Klasse 2MS (Geschichte und Deutsch) im Gymnasium Muttenz. Als Ausgangsmaterial und Inspiration dienten Archivquellen aus dem Staatsarchiv Basel-Stadt.
Schüsse fallen.
Noch nie habe ich mich gefragt, wie das allerletzte Gespräch mit jemandem stattfindet. Wie weiss ich, dass dies das letzte Lachen, das letzte Wort oder die letzte Berührung ist? Wie weiss ich, dass ich mir das alles einprägen muss, um es später vor meinem inneren Auge sehen zu können? Wüsste ich den Moment zu geniessen? Ich tat es nicht.
Das Herz schlägt mir bis zum Hals und pulsierende Stösse schiessen durch meinen Körper. Die Kacheln des Terrassenbodens unter mir verschwimmen. Mit der Hand ziehe ich mich ruckartig am Geländer hoch. Ich taumle durch die offene Verandatür. Dumpfe Schreie von draussen. Oder von drinnen. Oder von mir selbst. Schwankend tragen mich meine Füsse die Holzstufen der Treppe hinunter. Stufe für Stufe krache ich hinab. Als ich den kalten Fussboden unseres Eingangsbereichs erreiche, sehe ich die weit aufgerissenen Augen meines kleinen Bruders. Sein Mund ist verzogen und ganz langsam dringt sein Schrei zu mir durch. Seine Augen fixieren einen Punkt unter mir und als ich seinem Blick folge, sehe ich Blut. Kleine rote Punkte münden in immer grössere Blutseen und dann erblicke ich, was die Augen meines Bruders sehen. Meine Mutter liegt auf dem Rücken. Ihr Oberkörper ist leicht verdreht. Die braunen langen Haare liegen in einem Blutsee, welcher immer grösser wird. Ihre grünen Augen sind leblos und blicken ins Leere. Mitten in ihrer Stirn ist ein Einschussloch zu erkennen. Mir wird schlecht. Um mich herum ist es ganz plötzlich still. Ich erkenne nur noch Umrisse von Menschen, welche in hektischen Bewegungen an mir vorbei gehen. Sie drehen sich. Werden immer langsamer. Dann falle ich.
«Gibst du mir bitte noch das Hemd und den Rock von da drüben? Du kannst schon mal mit den beiden Hosen anfangen.» «Hier, fang!» Ich werfe meiner Mutter die beiden Klamotten zu. Sie landen direkt in ihrem Wäschezuber. Das Seifenwasser spritzt aus dem Zuber. Ich lache. Meine Mutter findet es nicht ganz so lustig. «Ach, Charlotte, kannst du nicht einmal sorgfältig mit den Kleidungsstücken umgehen? Du hast mich nass gemacht.» Wir waschen weiter. Ich sehe einige Soldaten am trüben Kellerfenster vorbeimarschieren. Sie gehen alle im Gleichschritt und folgen ihrem Offizier. Mit ihren Gewehren wirken sie furchteinflössend. Auf der anderen Strassenseite erkenne ich Kinder, welche mit einem Ball spielen. Als sie die Soldaten sehen, flüchten sie direkt ins Haus. Sie haben Angst, obwohl diese Soldaten ihnen nichts antun. Ich frage mich oft, wie lange diese bescheuerte Nachkriegszeit noch andauern soll. Wie lange geht es noch, bis sich die Situation wieder beruhigt hat. Dieser Gedanke geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. In unserer Familie sprechen wir nicht oft über den Krieg. „Mama, was denkst du, wie lange dauert dieser Krieg noch? Ich meine, es geht uns ja nicht besser durch den Krieg. Wir leiden alle nur darunter und haben doch nichts davon. Was genau soll er also bewirken?“ „Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Uns geht es nicht einmal so schlecht, wie du das jetzt darstellst. Ich verdiene als Schneiderin genug für uns alle und wir müssen uns auch keine Kleider kaufen.“ „Aber anderen geht es nicht so wie uns. Vater zum Beispiel hat im Moment fast keine Maleraufträge, da keiner Geld hat, um sich eine Hauswand streichen zu lassen, und auch Willi muss echt hart arbeiten, um sich über Wasser halten zu können. Kann man denn da nichts tun?“
Meine Mutter blockt mich weiter ab: „Wir können da nichts tun.“ Sie wäscht einfach weiter, als würden wir über nichts Relevantes sprechen. Wut kocht langsam in mir hoch. Sie gibt immer dieselben Antworten. Ich verstehe einfach nicht weshalb. „Willi hat mir aber erzählt, dass es bald irgendeinen Streik geben soll.“ Meine Mutter wird nervös. „Ich habe dir schon immer gesagt, Willi ist kein guter Umgang für dich. Er setzt dir immer solche Hoffnungen und dumme Gedanken in den Kopf.“ „Ihn kümmert es immerhin, was mit den Menschen im Krieg geschieht. Er schaut nicht einfach weg und ist zufrieden mit dem, was er hat. Im Gegensatz zu dir hockt er nicht nur den ganzen Tag vor der Nähmaschine und freut sich über neue, geschmeidige Stoffe. Er geht raus und versteht, was da draussen los ist, und ist nicht gefangen in seiner eigenen, kleinen Welt.“ Ich kann mich nicht mehr halten. Gerade möchte ich nochmals Luft holen, um ihr zu zeigen, wie viel eigentlich in mir steckt und dass ich nicht mehr das kleine Mädchen bin, welches sie beschützen muss. Doch genau in diesem Moment geht die Kellertüre auf und mein Vater kommt fröhlich hereinspaziert. Ich verstumme. Vorsichtig spähe ich nochmals in das Gesicht meiner Mutter. Ihr Blick ist ängstlich. Noch nie habe ich mich ihr so fremd gefühlt. Noch nie so weit weg und doch fühle ich mich gleichzeitig stark. Ich werfe die Kleider hin und stürme aus der Tür an meinem Vater vorbei. Ich laufe die Treppen hinauf, direkt ins Bad. Dort stütze ich mich am Beckenrand des Lavabos ab. Mein Herz pocht mir bis zum Hals. Ich schaue in den Spiegel und betrachte mich. Mein Blick ist entschlossen. So habe ich mich noch nie gesehen. Meine grünen Augen leuchten auf, während ich mich beobachte. Die braunen Haare fallen mir wild ins Gesicht. Je länger ich mich selbst im Spiegel betrachte, umso stolzer werde ich. Endlich habe ich mal gesagt, was gesagt werden musste. Ich fühle mich stark und bin entschlossen, dass ich etwas unternehmen möchte. Ich bin schliesslich nicht alleine. Da draussen leben hunderte Menschen mit derselben Hoffnung wie ich. Wir sind diejenigen, die etwas unternehmen müssen. Denn wer tut es sonst? Ich werde nicht einfach nur dahinleben und warten, bis jemand mal ein Feuer entzündet. Mit Willi und seinen Freunden kann ich etwas erreichen. Ich gehe in mein Zimmer und hole meine Jacke.
Willi stellt mir einen Teller dampfender Kartoffeln hin. Doch anstatt sich selbst auch hinzusetzen, läuft er mit grossen Schritten zurück in die Küche. „Wir hatten heute eine Versammlung mit unserer Arbeitsgemeinschaft. Du wirst mir nie glauben, was mir Phillipp erzählt hat.“ Ich beobachte Willi, wie er voller Energie durch die Küche wuselt. Während er spricht, gestikuliert er aufgeregt mit seinen Händen. „Ich habe dir doch schon mal vom Landesstreik erzählt.“ Ich nicke mit vollem Mund. „Die Landesregierung hat beschlossen, das Militär anzufordern. Das Militär, Charlotte!“ Ich verschlucke mich am Kartoffelstück zwischen meinen Zähnen. Ich muss husten. „Wie bitte?“, stosse ich zwischen Keuchen und Husten hervor. „Das ist nicht dein Ernst?“ Doch Willis Blick beantwortet meine Frage. „Sie wollen uns im Zaum halten, Lotte! Wie die Schafe wollen sie uns beruhigen, damit sie in Ruhe ihren politischen Krieg führen können. Wen kümmert schon die Bevölkerung? Der Bundesrat sitzt in seiner gepflegten Stube und erledigt Papierkram. Eine Unterschrift da, ein Stempel hier und schon ist für sie der nächste Kriegsschritt erledigt. Die Folgen spüren sie ja nur, wenn sie nicht mehr in ihrem Lieblingsrestaurant essen können. Aber dann gehen sie eben in ein anderes. Sie müssen ja nicht jeden Tag hoffen, dass es noch ein, zwei Kartoffeln auf dem Markt für sie hat.“ Ich folge Willis Worten. Beunruhigt rutsche ich auf meinem Stuhl hin und her. Klar, wir können nicht einfach nur davon sprechen, uns zu wehren. Wir müssen es schon auch tun. Doch mir wird erst jetzt klar, was da alles auf mich zukommt. „Die dürfen uns nicht klein kriegen“, sagt Willi, „Sie müssen sehen, dass die Bevölkerung keine Marionette ist, bei der man alle Fäden beliebig ziehen kann. “ “ Was habt ihr vor?“, frage ich unsicher. „Wir ziehen den Streik trotzdem durch. Wir sind nicht alleine. So viele Arbeiter und ganze Chemiearbeitergemeinschaften sind auf unserer Seite. Wir wehren uns mit denselben Mitteln. Wenn sie mit Gewalt drohen, so tun wir es auch. Sie sind nicht besser als wir. Ihre Position hält uns nicht auf!“
Er verschwindet im Zimmer nebenan. Als er zurückkommt, hält er ein gerolltes Papier in der Hand. Neugierig bleibe ich auf meinem Stuhl sitzen. Willi holt tief Luft und rollt das Papier schwungvoll aus. Ein Plakat. Darauf ein dicker Mann mit Krawatte, der kleinen Kindern Bücher und Instrumente aus der Hand reisst. Die Kinder tragen zerrissene Kleider und weinen. Der dicke Mann überragt die Kleinen mit seinem grossen Oberkörper und wirft einen schwarzen Schatten auf sie. Ich beisse mir sprachlos auf meine Unterlippe. Willi schaut mich erwartungsvoll an. „Genial, oder?“, ruft er begeistert. Immer noch sprachlos nicke ich mit grossen Augen. Ja, genial ist es. Die Regierung, die verantwortlich ist für die Hoffnungslosigkeit und graue Zukunft der Kinder, wird auf dem Plakat perfekt inszeniert. Die Spannung in meinem Körper löst sich langsam und ich rufe: „Das ist Wahnsinn! Ich bin dabei!“ Ich möchte den Kindern helfen, auch wenn es mir selbst vielleicht im Moment nicht so schlecht geht wie ihnen. Gerade jetzt fühle ich mich so lebendig wie noch nie. Mir wird bewusst, wie wichtig dieser Streik ist. Es braucht jeden einzelnen Kämpfer. Die Unsicherheiten sind verflogen. Den Rest des Abends verbringt Willi damit, mir zu erklären, wie der Streik aussehen soll und was ich tun kann. Mehrere Stunden sitzen wir am Tisch und diskutieren fiebrig. Ja, hier fühle ich mich verstanden.
Am Morgen des 1. August bin ich so wach wie noch nie. Heute findet der Streik statt. Heute können wir etwas ändern. Ich bin voller Zuversicht, meine Mutter hingegen ist angespannt und ein nervöses Nervenbündel. Ihre Augen sind geschwollen und sie sieht aus, als könne sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Ich meide ihren besorgten Blick. Sie kann mich nicht mehr umstimmen. Sie klappte fast zusammen, als ich ihr erzählt habe, wie unsere Pläne aussehen würden. Ich erklärte ihr, dass mich nichts davon abhalten könne, dass dieser Streik mir meine Augen öffne und ich mich so stark fühlen würde wie noch nie zuvor. Als ich gerade vom Frühstückstisch aufstehen möchte, hält mich ihre Hand zurück. Sie dreht mich zu ihr um und schaut mir in die Augen. „Charlotte“, ihr Blick ist flehend, „Bitte versprich mir, dass du nicht aus dem Haus gehst, ohne mir vorher Bescheid zu sagen. Bitte!“ Ich versuche dem Blick meiner Mutter Stand zu halten, doch etwas in ihren Augen bricht meine Sturheit. Meine Gesichtszüge werden sanfter. „Natürlich Mama, ich gehe doch nicht, ohne mich zu verabschieden.“ Ein kleines Lächeln versucht meine Worte zu unterstreichen. Doch meine Mutter wirkt nicht überzeugt. Dennoch nimmt sie mich in den Arm und hält mich lange fest. Ein wenig unwohl fühle ich mich schon. Ich weiss, wie sehr ich meine Mutter verletze. Doch es muss sein. Sie wird es später verstehen.
Es ist soweit. Ich sehe Willi vom Küchenfenster aus die Strasse heruntergehen. Mit eiligen Schritten laufe ich die Treppe hinab und reisse die Haustüre auf. Ich begrüsse Willi aufgeregt, doch sein Blick verrät mir, dass etwas nicht stimmt. Er blickt mich mit ernster Miene an. „Was ist, wollen wir gehen?“, frag ich. „Lotte, es tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Es ist viel zu gefährlich.“ Fassungslos blicke ich ihn an. „Aber … wir wussten doch von Anfang an, dass es gefährlich würde.“ Er merkt, wie wütend ich werde, und versucht mich zu beruhigen. „Ja schon, aber die Lage ist ernster, als wir sie eingeschätzt haben. Ich kann nicht verantworten, dass dir etwas zustossen könnte.“ Er sieht mich flehend an. „Aber du hast selbst gesagt, dass es jeden Einzelnen braucht.“ Ich kann es nicht glauben. Verzweifelt verzieht er das Gesicht. „Bitte vertraue mir. Falls sich die Lage beruhigt, werde ich dich abholen.“ Ich knalle die Türe vor seiner Nase zu. Rasend vor Wut gehe ich auf die Terrasse. Dort arbeitet mein Vater gerade an einem Neuanstrich der Terrassentüre. Ich setze mich wortlos hin. Mein Vater stellt keine Fragen. Er weiss, dass ich sowieso keine zufriedenstellende Antwort geben werde. Er lächelt nur und lässt mich in Ruhe. Mein Kopf arbeitet immer noch auf Hochtouren, doch mein Puls beruhigt sich langsam. Die Pinselstriche meines Vaters und die synchronen Schritte der Armee unter uns auf der Strasse verschwimmen zu Nebengeräuschen. Im Vordergrund stehen meine Gedanken. Doch dann knallt es. Ein Gewehr. Ganz nahe. Sehr nahe. Direkt unter uns. Direkt vor unserem Haus. Und der Schuss hat etwas getroffen. Ich stehe auf. Ich renne. Sehe Blut. Sehe meine Mutter. Sie atmet nicht. Dann wird alles schwarz.
5 Tage später
Kartoffelsuppe zum Abendbrot. Die erste Mahlzeit seit Tagen. Und das auch nur, weil mein Magen es nicht mehr länger aushält. Löffel für Löffel schlucke ich mühsam hinunter, füttere meinen Magen, bis er endlich still ist. Schweigend. Mein Bruder hat seinen Teller noch nicht berührt. Meine Schwester weint. Mein Vater sitzt zusammengesunken vor uns. Schweigend. Er hebt seinen Blick. Die Augen sind blutunterlaufen. Tagelange Schlaflosigkeit zeichnet sich in seinem Gesicht ab. Mein kleiner Bruder Paul ist heute aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er trägt einen Verband um den Kopf. Die Wunde muss noch geschont werden, doch der Splitter wurde entfernt. Von der Kugel selbst wurde er nicht getroffen. Mein Vater schaut mich an. „Es gibt Neuigkeiten.“ Er bricht die Stille. „Das Gericht hat sich gemeldet. Es wird einen Prozess geben.“ Wir sagen immer noch kein Wort. Meine Schwester Margaretha hört auf zu schluchzen. „Der Soldat soll eine Strafe bezahlen.“ Er holt tief Luft. „Hört zu. Ich bekomme fast keine Aufträge. Keiner braucht einen Maler, wenn man sich nicht mal die Mieten leisten kann. Eure …“ Er schluckt. „Eure Mutter hat sehr gut verdient. Ihr Lohn entfällt uns jetzt.“ Er kämpft gegen die Tränen. „Es wird sehr knapp, doch das Gericht wird uns helfen. Der Soldat, der eure Mutter …“ Er bricht wieder ab und fährt sich mit der Hand durch die grauen Haare. Margaretha weint wieder. Paul schweigt. „Er muss uns Geld bezahlen, so dass wir leben können, doch das kann dauern. Vielleicht wird der Prozess erst in ein paar Monaten zustande kommen. Bis dahin“, er fixiert mich, „müssen wir zusammenhalten. Jeder muss mithelfen. Wir werden sparen. Aber gemeinsam werden wir die schweren Zeiten durchstehen.“ Seine Stimme zittert und ich weiss, dass er sich nicht sicher ist. Er schaut mich immer noch an, erwartet von mir zustimmende Worte. Ich sehe Paul und Margaretha an. Meine Geschwister brauchen mich. Zögernd bringe ich mich dazu, meinen Mund zu öffnen: „Wir sind ja eine Familie. Das ist alles, was wir brauchen.“ Mein Vater schaut mich dankbar an. Paul nickt und meine Schwester hört wieder auf zu weinen. „Doch wir sollten früh schlafen gehen. Paul, du musst dich ausruhen und wir alle können den Schlaf auch gebrauchen.“, sage ich und begleite meine Geschwister ins Zimmer.
Danach lege ich mich selbst in mein Bett. Doch der Schlaf kommt wieder nicht, so wie in den letzten Nächten. Blut blitzt vor meinen Augen auf. Blutseen. Der leere Blick meiner Mutter. Immer wieder höre ich ihre Stimme: „Bitte, versprich mir, dass du nicht aus dem Haus gehst, ohne mir vorher Bescheid zu sagen.“ Es hallt in meinem Kopf. Immer und immer wieder. Ich habe ihr nie gesagt, dass ich doch nicht zum Streik gehe, dass ich zu Hause bleibe, dass sie sich keine Sorgen mehr machen muss. Stattdessen liess ich sie in ihrem Glauben und in ihrer Sorge. Deswegen rannte sie hektisch vor die Türe. Wegen mir. Sie hatte Angst. Sie dachte, ich sei schon gegangen. Sie konnte mich wahrscheinlich nirgends finden. Sie rannte nach draussen, wegen mir, wollte mich aufhalten. Die Soldaten erschraken und schossen. Sie ist tot. Wegen mir! Es ist meine Schuld. Ich habe ihr in den letzten Tagen nur noch Sorgen gemacht. Ich versuche die Gedanken abzuschütteln. Schon tausendmal bin ich jeden einzelnen durchgegangen. Sobald ich mich hinlege, tauchen sie auf und lassen mich nicht mehr alleine. Ich kann nicht mal mehr weinen. Ich bin völlig leer. Nach einer Weile schlafe ich endlich ein.
Neun Monate später
Hunger. Ich bin völlig leer. Mein Bauch zieht sich zusammen.
Die Gerichtsverhandlung fand gestern Nachmittag statt. Doch anstatt dass wir uns freuen, hungern wir einfach weiter. Es hat sich nichts, aber auch gar nichts geändert. Der Soldat muss nicht zahlen. Noch nicht. Der Bundesrat steht hinter ihm. Er habe nur im Sinne der Gemeinschaft und nach seinen Anordnungen gehandelt. Er habe nichts zu verantworten. Es wird eine weitere Verhandlung geben. Doch wann? Wir können nicht nochmals neun Monate warten. Wir brauchen das Geld jetzt. Ich kann keinen Tag länger hungern. Wir müssen etwas essen. Mein Vater meldet sich in regelmässigen Abständen beim Bundesrat, um ihm unser Leiden vor Augen zu halten. Er verdient im Moment nichts, weil er keinen einzigen Auftrag erhält. Willi kam gestern Abend und brachte uns zwei Kartoffeln vorbei. Er konnte sie gerade noch auf dem Markt ersteigern. Zwei Kartoffeln. Für Vier. Es reicht nicht.
Drei Monate später
Es ist der 1. August 1920. Ein Jahr seit dem Tod meiner Mutter. Doch wir können nicht jeden Tag trauern. Es wird einfacher. Wir beschäftigen uns also. Paul und Margaretha sitzen neben mir auf dem Boden. Wir spielen gerade Memory. Paul ist mal wieder dabei zu gewinnen. „Einmal eine Katze und …“, er zieht die zweite Karte, „nochmals eine Katze!“ Strahlend nimmt er die Karten zu sich. Ich muss lächeln über seine Freude. Dann geht die Wohnzimmertüre auf und unser Vater kommt nach Hause. Er schenkt uns ein warmes Lächeln zur Begrüssung. „Ich habe Kartoffelbrot erhalten.“ Wir springen auf vor Freude. Aufgeregt setzen wir uns an den Esstisch. So viel zu essen hatten wir schon lange nicht mehr. Der Prozess ist noch nicht vorüber. Die zweite Verhandlung fand noch nicht statt. Wir haben immer noch kein Geld und hungern weiter. Doch mit jedem Tag wird es routinierter. Man gewöhnt sich an das leere Gefühl. Ich zünde eine Kerze an und stelle sie in die Mitte unseres Tisches. Wir setzen uns und mein Vater sagt: „Eure Mutter wäre stolz auf euch.“ Er lächelt schwach. „Wir geben nicht auf. Es ist allein unser Zusammenhalt, der uns weiterträgt.“ Ich schaue auf die Tischplatte. Die Schuldgefühle sind noch nicht weg, doch die Blicke meiner Geschwister erinnern mich daran, dass ich ihnen zeigen muss, dass alles in Ordnung ist. Wir müssen nicht mehr traurig sein. Ich lächle ihnen müde zu, als sie mich ansehen. Sie nehmen mein Lächeln sofort an und ihre Blicke entspannen sich. Wir essen langsam und lange. Natürlich nur das halbe Brot, so dass wir Morgen noch zu essen haben. Nach dem Abendbrot waschen wir gemeinsam ab. Danach bringe ich Paul und Margaretha ins Bett. Bevor ich mich selbst ins Bett lege, gehe ich noch ins Bad. Ich betrachte mich im Spiegel. Meine knochigen Schultern hängen nach vorne und meine Haltung ist gekrümmt. Ich sehe klein aus. Meine Wangen sind eingefallen, genau wie bei meinen Geschwistern. Wir sehen uns ähnlicher als je zuvor. In meinen Augen erkenne ich dieselbe stille Trauer, wie bei Paul und Margaretha. Mein Blick ist unsicher. So genau habe ich mich schon lange nicht mehr angesehen. Ich kenne die Gesichter von Paul und Margaretha schon besser als mein Eigenes.
Plötzlich muss ich an das Plakat von Willi denken, das mit den Kindern und dem dicken Mann. Ich kann nicht erklären wieso, doch ich sehe in meinem Spiegelbild plötzlich das Kind in mir. Dieses Kind hat grosse Ähnlichkeit mit den Kindern auf dem Plakat. Ich bin ängstlich. Der Krieg hat uns viele Möglichkeiten weggenommen. Wir können nicht zur Schule, weil das Geld nicht reicht. Wir fühlen uns klein, weil wir keine Zukunft haben. Die Regierung hat in der Hand, was mit uns geschieht. Wir sind wieder einmal nur die Marionette. Auf einmal verändert sich meine Sichtweise. Ich sehe meine Mutter. Meine Mutter, die nicht über den Krieg sprechen wollte, die in ihrer kleinen Welt wohnte. Das einzig Wichtige für sie war unsere Familie, nicht die Welt da draussen. Genau das sehe ich jetzt auch. Seit Monaten habe ich keinen Gedanken an die Arbeiterschaft und den Aufstand verschwendet. Ich denke nur daran, ob wir heute etwas zu essen haben und ob es Paul und Margaretha gut geht. Ich bin damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass wir als Familie durchkommen. Auf einmal verstehe ich meine Mutter. Ich sehe unsere Familie mit ihren Augen. Das Wichtigste ist das Wohl meiner Geschwister. Alles andere hat keinen Platz in unserer Welt. Sobald Paul oder Margaretha nach draussen gehen, bin ich besorgt und das Gefühl lässt erst nach, wenn sie wieder zu Hause sind. Ich blicke in meine Augen und sehe meine Mutter. Plötzlich verstehe ich jede ihrer Handlungen und jedes ihrer Worte. Eine Träne läuft meine Wange hinab. So schlimm dieser Zeit auch ist, ich war meiner Familie noch nie so nah. Ich werde diesen Krieg nicht schönreden. Er bleibt grausam. Wir leiden alle und er hat uns Menschen unsere eigenen kleinen Kriege gebracht. Wir kämpfen an unseren eigenen Fronten. Jeder hat einen anderen Standpunkt und sein eigenes Leid. Doch wir sind als kleine Familie zusammengewachsen. Wir sind nicht alleine. Ich bin nicht mehr das fröhliche, temperamentvolle Mädchen von früher. Ich bin schnell erwachsen geworden. Als ich mich jetzt im Spiegel ansehe, habe ich das Gefühl, ich habe alles gesagt. Das Bedürfnis, meiner Mutter noch so vieles sagen zu müssen, fällt langsam von mir ab. Ich weiss, sie hat mich verstanden. Und jetzt verstehe ich sie auch. Ich lächle. Noch nie war ich meiner Mutter so nah.
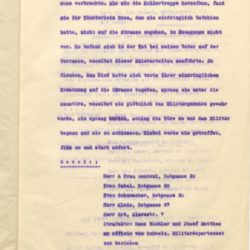
Neueste Kommentare